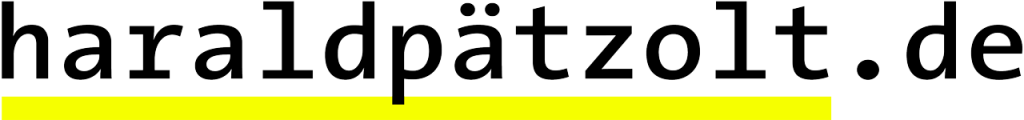(Veröffentlicht in: Elternhaus und Schule 6/91, S. 6 – 7)
Über das Thema Frieden und unseren Umgang mit Kindern – eigenen, uns anvertrauten und fremden – zu schreiben, das stieß bei mir auf ganz unerwartete Widerstände. Vor allem drei Bedenken versperrten mir plötzlich den Weg:
Ist erstens nicht schon alles Wesentliche zu diesem Thema irgendwann von irgendwem gesagt worden? In der Tat, seit Menschengedenken beschäftigte die Frage nach den Möglichkeiten friedlichen Zusammenlebens viele große Geister. Und die Zahl der Wissenschaftlerinnen, PädagogInnen, PsychologInnen, die sich zu Themen wie Aggression, Konfliktverhalten und anderen Aspekten der Friedenserziehung äußern, nimmt stetig zu. Ist dem noch etwas Neues hinzuzufügen? Oder gehört das Thema Kinder und Frieden zu denen, die es erforderlich machen, das tausendmal Gesagte zum tausendersten Mal zu sagen, damit es nicht doch überhört wird. Ist zweitens nicht Skepsis angebracht, wenn dieses Thema so vermarktet wird? Schließlich verdienen Expertinnen in Sachen Krieg und Frieden ihren Lebensunterhalt damit. Es ist ihr job. Für die Medien ist das Thema eines, das zum Geschäft gehört. Stimmt es, daß laute Reden über Hoffnung heute nur zynische Fabrikate sind, daß, wer hoffen will, dies still tun muß? Endlich die dritte Sorge: Frieden als pädagogische Idee – belasten wir da nicht Kinder mit der Verantwortung, ein Problem zu lösen, welches wir selbst nicht zu lösen vermögen? Ist vielleicht die Pädagogisierung der globalen Menschheitsprobleme ein Schleichweg heraus aus eigener Verantwortung?
Ich kann und will diese Bedenken nicht ausräumen. Nehmen Sie sie als Anmerkungen zum Problem, das der große Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeld so formuliert hat: „Es geht darum, wie die Tatsache aus der Welt zu schaffen sei, daß völlig gesunde, im Alltag freundliche junge Männer in den Krieg ziehen und dann Mitmenschen umbringen.“
Und auf diese Tatsache gibt es nur eine vernünftige Antwort. Die hat Heinrich Mann schon 1937 formuliert: „Man muß immerfort handeln und etwas tun. Wer nur zusieht, wartet vergeblich, daß Frieden kommt. Von allein kommt nur der Krieg.“
In diesem Sinne muß man also auch im Umgang mit den Kindern etwas tun. Dieses „Muß“ beinhaltet eigentlich keine Forderung, keinen Appell an andere. Es drückt vielmehr aus: Ich kann einfach nicht anders. Ich muß darüber mit meinen Kindern reden. Ich muß mit anderen gemeinsam etwas unternehmen, um dem Frieden näher zu kommen. Dazu aber, sich selbst zu befragen, braucht es Zeit. Ruhe. Muße. Also das, was wir heute am meisten in unserem Alltag vermissen.
Schon ist der Golfkrieg wieder aus unseren Gedanken verschwunden. Dabei interessiert es mich brennend, wie die vielen hunderttausend Soldaten aus den USA und den anderen Staaten das alles dort erlebt haben. Wie wird man damit fertig, so viele Menschen „sauber“ getötet zu haben? Hat der moderne Krieg für den Sieger allen Schrecken verloren? Haben sie Angst gehabt, die Helden? Wovon träumen sie nun und die nächsten Jahre? Und was werden sie ihren Kindern erzählen? Werden sie ihre Jungs, wenn die groß sind, in die Army schicken? Und worüber würden wir miteinander reden, wenn wir uns träfen?
Das sind Gedanken, die manchem von uns vielleicht in den Sinn kommen. Ist die Antwort auf die Frage, ob Deutsche beim nächsten Mal mittun sollen und ob ich meinen Kindern zur Verweigerung raten soll, noch einfach? Ich denke, sie ist es nicht. Alle raschen Antworten, auch die der Friedensforscher, haben etwas Gewaltsames an sich. Sie wollen beeindrucken. Vielfach schaffen sie das. Aber sie werden eben auch rasch widerlegt.
Kriege seien heute nicht mehr führbar. Oder nicht gewinnbar. Sie seien kein Mittel mehr, Probleme zu lösen. Das war zu einfach gedacht. Das kommt, wenn irgendwann das Fragen aufhört. Wenn man fertige Antworten hat. Rezepte. Das geschieht uns immer wieder. Gerade auch bei den Lieblingsthemen der Friedenspädagogik. Wie ist das mit dem Kriegsspielzeug? Zu einfach, zu sagen, es sei zu ächten. Erstens gelingt dies nur punktuell, in Oasen gewissermaßen. Zweitens ignoriert man, daß die militärische, die militarisierte Realität von den Kindern (nicht nur, aber auch) spielerisch bewältigt werden muß. Und oft vergißt man die eigene Erfahrung mit derartigem Gerät. Bin ich nicht trotz intensivster Beschäftigung mit solchem Spielzeug (oder vielleicht auch wegen derselben) zu vernünftigen Einsichten gekommen? Selbstbefragung. Und dann die Mitteilung der Resultate des Erinnerns. Überraschung: Die von mir so selbstverständlich behauptete Faszination des Technischen an Waffen, auch am militärischen Spielzeug, ist so selbstverständlich gar nicht. Ruhig, fast behutsam, teilt mir eine Kollegin mit, daß sie und andere Frauen diese Faszination, das tolle Gefühl des schweren, kalten Metalls einer Waffe als Mädchen ebensowenig empfunden haben und heute nachvollziehen können wie die durchaus vorhandene, wenn auch gebremste Begeisterung für Boxen, Fußball oder ähnliches.
Nachfrage ist also notwendig. Es mag merkwürdig klingen, aber ich erlebe es so: Auch in der psychologischen und pädagogischen Friedensforschung bekommt man entschieden mehr Antworten mitgeteilt als Fragen, Nachfragen gestellt. Das ist keine gute Ausgangsbasis fürs Handeln, von dem Heinrich Mann im obengenannten Zitat sprach. Überhaupt ist es dabei in der Wissenschaft wie in der pädagogischen Praxis: Unsere PartnerInnen wollen nicht nur gefordert, sie wollen auch gefragt sein. Dafür gibt es gerade in der Friedenserziehung einen ganz einfachen Grund: Erkenntnis und das notwendige Tun für den Frieden ist nur kooperativ, im Miteinander möglich. Niemand kann aus besserer Einsicht für andere die Verantwortung und Entscheidung über Krieg und Frieden übernehmen. Wie das im Großen ausgeht, wenn Regierungen, Militärs und andere Eliten darüber entscheiden, ist bekannt. Wir sollten niemanden, auch unsere Kinder nicht, zum Frieden bekehren, ihnen den Frieden einreden. Gemeinsam auf dem Frieden bestehen, nach Wegen suchen und diese gehen – das sollten wir tun. Hören wir noch einmal Irenäus Eibl-Eibesfeld: „Krieg und Frieden sind Alternativen, für die wir Anlagen mitbringen. Die Tatsache, daß wir diese Zusammenhänge durchschauen, gibt uns die Möglichkeit, uns zu entscheiden, und wie immer wir die Weichen stellen – wir tragen die volle Verantwortung.“