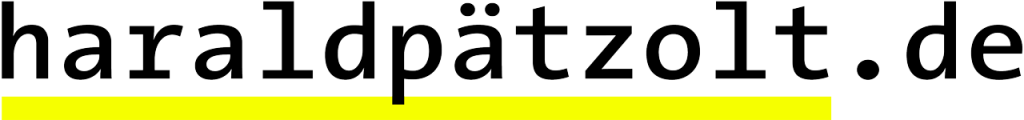(Veröffentlicht in: Disput, Juli 2006)
Ein Kommentar zu drei Beiträgen über die SPD-Programmdebatte im Juni-Heft der Zeitschrift „Sozialismus“
Brauchen wir ein neues Programm, weil wir eine neue Partei gründen? Oder wollen wir eine neue Partei gründen, weil in einer veränderten Welt nur so neue Herausforderungen bewältigt werden können?
Wollen wir die Beteiligung möglichst vieler an dieser Programmdebatte, um soviel Mitglieder wie nur möglich in die neue Partei „mitzunehmen“? Oder wird in dieser Programmdebatte jede Genossin und jeder Genosse eben darum gebraucht, weil nur durch sie und mit ihnen die Veränderungen in unserer Gesellschaft, im Alltag, beschrieben, analysiert und verstanden werden können? Weil nur mit der Erfahrung und dem Wissen vieler die Antworten auf neue politische Fragen gefunden und verständlich formuliert werden können?
Wird das neue Programm sich vor allem durch seinen Kompromisscharakter auszeichnen? Dass jede Strömung und Partei möglichst viel „bewahrt“ und „erhält“, dialektisch geschult „aufhebt“? Oder wird sich das neue Programm dadurch auszeichnen, dass es mutig, kraftvoll und leidenschaftlich die politischen Aufgaben der sozialistischen Linken in Deutschland benennt?
Wir stehen in einem programmatischen Parteienwettbewerb. CDU und SPD haben sich ebenfalls auf den Weg zu neuen Parteiprogrammen gemacht. Besonders die Programmdebatten der SPD und von Linkspartei und WASG sind alles andere als unabhängig voneinander. Es ist darum von Interesse, wie Linke außerhalb der Linkspartei, in der SPD und in deren Umfeld, die SPD-Programmdebatte kommentieren. Mit einem Auge blicken sie immer auch auf unsere Debatte.
Worin sehen sie positive Ansätze?
Die Redaktion der Zeitschrift „Sozialismus“ stellt im Juni-Heft dieses Jahres heraus, dass die Sozialdemokratie sich wieder auf ihre traditionelle Stammwählerschaft besinnen will. Die Autoren zitieren Kurt Beck: „Ohne vernünftige Verteilungsgerechtigkeit, ohne eine vernünftige materielle Grundlage für die Menschen kann es letztendlich auch keine Chancengleichheit geben. Wir wissen, dass das so ist. Deshalb ringen wir um beides.“ Eine Linkswendung, merkt die Redaktion an, sei damit allerdings nicht angekündigt. Aber, so kommentieren sie weiter: „Dass in der Sozialdemokratie der Nach-Schröder-Ära auch wieder über soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit diskutiert werden soll, zeigt, dass der Prozess der Selbstsuggestion der SPD als Regierungspartei noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass die offenkundigen Widersprüche des Neoliberalismus nicht mehr zur Kenntnis genommen würden.“
Jörg Deml findet positiv, dass in den Leitsätzen für die Programmdiskussion der SPD die Ambivalenzen und Entwicklungen sozialen Wandels benannt werden (Prekarisierung einerseits und kreative und eigenverantwortliche Arbeit andererseits, Massenarbeitslosigkeit, Verschiebung der Einkommen und Vermögen zu Lasten der Arbeitnehmer und kleinen Selbständigen usw.). Wichtig sei auch, dass das Scheitern des „Marktradikalismus“ in dem SPD-Papier festgestellt werde. Und richtigerweise stünde die Positionierung zum Sozialstaat im Mittelpunkt der Programmdebatte.
Wo werden die Schwachstellen der „Leitsätze“ gesehen?
Jörg Deml kritisiert, dass „…nicht der Versuch unternommen (wird), die Ursachen der ›Herausforderungen der Europäisierung, der Globalisierung und des sozialen, demographischen und technischen Wandels‹ zu analysieren“. Auch würden die Ursachen für die falsche Politik und die dahinter stehenden Interessen nicht benannt und analysiert. Endlich litten die „Leitsätze“ generell daran, dass sie keine Position bezögen. Die richtigen Fragen wären: Wer sind die Subjekte der Gesellschaft, welche Interessen haben sie und wie werden diese politisch handlungsrelevant? Wessen Interessen vertritt die SPD? Wie steht sie zur Arbeitnehmerschaft? Die „Leitsätze“ orientierten die SPD eher auf den Einzelnen. In dem SPD-Dokument heißt es: „Wir sind keine Partei für eine bestimmte Klasse, Schicht, Region oder einzelne Gruppe.“ Dies führe in der Konsequenz zu einer Beliebigkeit bei der Bestimmung der Zielgruppen sozialdemokratischer Politik. Und: Zwar sei der Sozialstaat im Fokus der Programmdebatte, aber ohne ein Leitbild ökonomischer Entwicklung unter heutigen Bedingungen könne keine Sozialstaatspolitik gemacht werden. Ein solches Leitbild blieben die „Leitsätze“ aber schuldig.
Kai Burmeister und Thilo Scholle kritisieren in ihrem Beitrag, dass es in der SPD-Programmdebatte keine Wahlauswertung gebe und eine Gesellschaftsanalyse fehle. Das wesentliche Manko der SPD sei das Ausblenden der Veränderungen des Kapitalismus in den Bereichen der Ökonomie (Finanzialisierung) sowie der Arbeits- und Lebenswelt (vor allem der neuen Prekarisierung).
Die Redaktion der Zeitschrift „Sozialismus“ findet, dass nicht erkennbar sei, worin die Substanz eines „vorsorgenden Staates“ bestehe, dessen sozialdemokratische RepräsentantInnen die Minister Müntefering, Steinbrück und Schmidt sein müssten. Woher wolle man die Ressourcen für eine Politik gegen verfestigte Ungleichheit holen?
Ein Problem der Programmdebatte in der SPD sei der tiefe Graben zwischen der Politik ihrer RepräsentantInnen in der Großen Koalition und dem Elend des gesellschaftlichen Alltags. Ein weiteres Problem der Programmdebatte der SPD bestehe in der Verselbständigung auch eines großen Teils der sozialdemokratischen Mitglieder der politischen Klasse. Und schließlich leide diese wie aktuell jede Programmdebatte darunter, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, auch der Parteimitglieder, in die Ernsthaftigkeit programmatischer Verständigung und ihre Relevanz für praktische Politik wie Eis in der Sonne geschmolzen sei.
Was wir aus diesen Reflexionen auf jeden Fall lernen sollten, ist: Jede, auch unsere Programmdebatte wird von den Bürgerinnen und Bürgern immer und umstandslos an der politischen Praxis gemessen. Und: Eine Programmdebatte macht keinen Sinn, wenn man nicht auf eine andere politische Praxis aus ist.