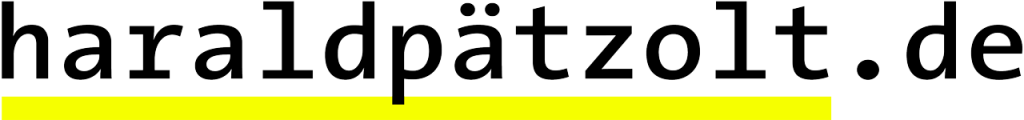Vortrag beim Kurt-Eisner-Verein, München, 12. März 2010
(Veröffentlicht in: Studienreihe Zivilgesellschaftliche Bewegungen – Institutionalisierte Politik, Nr. 16/2010. Beilage zu MitLinks Nr. 32.)
Weit über linke Kreise hinaus gilt heute als selbstverständlich, dass wir mehr direkte Demokratie brauchen. In Deutschland, aber eigentlich überall in der Welt. Direkte Demokratie ist etwas fraglos Gutes,während die repräsentative Demokratie mit ihren Parteien und Parlamenten, gewählten Abgeordneten und Amtsträgern (Politikern) den denkbar schlechtesten Ruf hat.
Was politisch aus einer solchen Gewissheit folgt, scheint ebenso klar zu sein: Wenn man mehr direkte Demokratie will, dann muss man erstens die Bedingungen dafür verbessern, also die Höhe der Quoren verringern, die Zulassung erleichtern, Zulässigkeiten (d. i. die Gegenstände, über die befunden werden darf) erweitern, die Kosten verringern und die Fristen verlängern. Zweitens wären weitere politisch – administrative Ebenen für Formen direkter Demokratie (Gesetzes- und Verfassungsinitiativen) zu erschließen – bis hin zur völligen Volksgesetzgebung. Soweit scheint die Sache recht klar und für die jüngste Vergangenheit werden ja in diesem Sinne, wenigstens auf „unteren Ebenen”, tendenzielle Fortschritte berichtet. So vollziehe sich seit Anfang der 90er Jahre ein schleichender Siegeszug der direkten Demokratie in Deutschland.1 Allerdings löst sich viel abstrakte Selbstverständlichkeit rasch auf, wenn es um konkrete Fragen geht. So mag man schon Grenzen ziehen und nicht über alles abstimmen lassen, etwa über die Todesstrafe und man findet z.B. die sogen. Beteiligungsquoren wegen der damit möglichen Gegenstrategie der Demobilisierung der eigenen Parteigänger problematisch. Aber darüber will ich hier nicht reden. Vielmehr will ich einige Annahmen, die quasi als Gründe für die Selbstverständlichkeit, dass direkte Demokratie gut und mehr davon besser sei, angeführt werden, thematisieren.
Die erste Annahme betrifft das Menschenbild des mündigen Bürgers. Diese Annahme gibt es in mehr oder weniger optimistischen Ausprägungen. Der mündige, politische Mensch, der Bürger wird vorausgesetzt und behauptet, es gäbe für diesen zu wenige Möglichkeiten politischer Partizipation. Diese eher optimistische Sicht wird in der bundesdeutschen Literatur besonders energisch von H.H. von Arnim vertreten.2 Eine etwas weniger optimistische Sicht sieht eher Defizite politischer Sozialisation bei den Bürgern und findet den zweiten, vielleicht aber auch den ersten Zweck der Einführung bzw. Erweiterung direkter Demokratie in der politischen Erziehung der Menschen, in deren Politisierung, einer Demokratisierung der Bevölkerung. Beide Varianten der ersten Annahme sind im einzelnen natürlich historisch konkret belegbar. Ebenso belegbar dürften die regelmäßigen Enttäuschungen über den Mangel an Nachhaltigkeit dieser Effekte sein. Nicht nur in Ländern, die nach Umstürzen oder durch politische Reformen an der Schwelle zur Demokratie stehen, auch bei uns im Land zeigt sich immer wieder, dass wir es mit temporär begrenzten Prozessen politischer Mobilisierung und Partizipation zu tun haben, die Bürgerhaushalte scheinen da prototypisch zu sein.
Ich neige dazu, hinter dieser Annahme eine allgemeinere Fragestellung zu vermuten als die nach der Steigerung politischer Partizipation durch (mehr) direkte Demokratie.3 Moderne Wettbewerbsdemokratien zeichnen sich gegenüber andern Staatsformen durch den prinzipiell freien Zugang zu politischer Aktivität, zu politischen Organisationen und zum politischen Wettbewerb selbst aus. Sie zeichnen sich nicht durch einen höheren Anteil an politischer Aktivität, einen höheren Organisationsgrad oder eine gesteigerte Konkurrenz aus. Politische Partizipation ist also kein Maßstab für Demokratie. Gleichheit im genannten Sinne, also die reale Möglichkeit für jede/n und alle aber ist ein Kriterium. So gesehen ginge es um eine Erweiterung der Teile der Bevölkerung, die in einem solchen Sinne des open access [freien Zugangs – Red.] politisch gleich wären. Es ginge um eine extension of citizenship [Ausweitung des Bürgerrechts – Red.]. In Deutschland und Europa hätten wir da durchaus wichtige Aufgaben zu lösen: Es ginge um politische Rechte von Migrantinnen und Migranten,
um das Wahlrecht Jugendlicher, für die EU möglicherweise um ein wirkliches Parlament, einen europäischen Staat. Aber, und das scheint mir wichtig zu sein, die Frage, wie wir diese extension of citicenship voranbringen könnten, verweist nicht umgehend auf den Bereich der direkten Demokratie, sondern es scheint so, als wäre diese Frage sowohl mit Blick auf die repräsentative Demokratie (z.B. Wahlrecht) wie mit Blick auf die Möglichkeiten direkter Demokratie zu diskutieren.
Eine zweite Annahme ist die, dass wir in Deutschland ein grundlegendes Demokratiedefizit haben, weil relevante Teile des Volkes eben parlamentarisch nicht repräsentiert werden. Ein Repräsentationsproblem also begründet die Notwendigkeit direkter Demokratie. Das scheint zunächst plausibel, als Tatsachenbeschreibung ist das Argument populär. Dabei läge es jedoch nahe, eine andere Schlussfolgerung zu ziehen und nach Wegen zu suchen, etwa durch Änderungen des Wahlrechts diesem Mangel abzuhelfen. Ich beobachte jedoch, dass es eine gewisse Neigung innerhalb der Linken gibt, auch bei dieser Frage rasch prinzipiell, also abstrakt zu werden und sich mit den sogenannten Grenzen der (bürgerlichen) Demokratie zu befassen, also damit, ob, wenn Demokratie Herrschaft der Mehrheit sein soll, wir eine solche tatsächlich haben oder ob Repräsentation und Volkssouveränität überhaupt zueinander passen. Beides wird dann in der Regel verneint und als Alternative oder wenigstens Ergänzung die direkte Demokratie gefordert.
In der Tat kann man mit Siegfried Landshut von der Aporie [unauflösbare theoretische Problemstellung -Red.] einer Repräsentativversammlung auf dem Boden der Volkssouveränität sprechen.4 Landshut weist darauf hin, dass mit Art. 20 (Volkssouveränität) und Art. 38 GG (Prinzip der Repräsentation) zwei heterogene Auffassungen von der Konstitution, der Verfassung eines politischen Gemeinwesens schlechthin, vorliegen, deren Widersprüchlichkeit spätestens seit der Französischen Revolution öffentlich geworden ist. Landshut macht aber auch einen interessanten Vorschlag, wie das Prinzip der Repräsentation anders aufgefasst werden kann und sich damit das Problem der sogen. Repräsentationsdefizite besser bearbeiten lässt: Nicht Personen(Wählerschaften, Parteien, Schichten oder Milieus) werden repräsentiert, sondern das, was die Identität einer politischen Gemeinschaft ausmacht. Etwas Ideelles, ein regulatives Prinzip, der jeweilige way of life, Grundüberzeugungen werden durch (gewählte) Personen repräsentiert. Lassen wir diesen Gedanken einmal gelten, dann könnten wir sagen, dass die Parlamentarier personal wie als Institution Parlament Grundüberzeugungen wie Inklusion, Gleichheit, geteilter Reichtum, Grundrechte des GG, Zugang zu öffentlicher Daseinsfürsorge repräsentieren, d.h. sich von diesen leiten lassen – im Unterschied zu den privaten individuellen Interessen der Bevölkerung. Funktioniert das nicht und die Interpretationen der Parlamentarier gehen zu weit auseinander, dann wachsen in der Bevölkerung Zweifel am System und die Grundüberzeugungen selbst werden schwächer. Das wird dann als „Ungerechtigkeit” empfunden und wiederum den Personen, die diese Ideen oder Grundüberzeugungen repräsentieren sollen, zugeschrieben.
Zur Korrektur einer solchen Entwicklung taugt direkte Demokratie wahrscheinlich kaum. Aber das Parteiensystem selbst, das Wahlrecht, die Versammlungs- und Organisationsfreiheit bieten genug Möglichkeiten, längerfristig korrigierend wirksam zu werden. Jüngstes Beispiel ist die Entstehung der Partei DIE LINKE selbst.
Eine dritte Annahme ist die, dass das Demokratiedefizit in der Entartung der Parteien, der Politiker und des Parlaments selbst begründet ist. Das scheint zunächst aufs Gleiche hinauszulaufen wie die zweite Annahme: Die nach Art. 20 GG vom Volk Beauftragten erfüllen ihren Auftrag schlecht und nutzen ihre Unabhängigkeit nach Art. 38 GG zum Verfolgen eigener Interessen, die dann gern Klientelinteressen sein können. Damit haben wir dann das von links immer wieder beklagte Modell des Gegeneinander von Mehrheit und Parlament.
Was daraus folgt, wenn damit ein systemimmanenter Grundfehler beschrieben ist, ist eine Stärkung der plebiszitären Elemente gegenüber den repräsentativen Elementen. Möglicherweise eine Präsidialdemokratie und/oder mehr Gesetzesinitiativen (Volksgesetzgebung).
Es gibt aber noch eine andere Lösung, die auf einer etwas anderen Perspektive basiert: Eine genauere Diskussion des Amts- und Demokratieprinzips (Art. 38 und Art.4 GG).5 Man sieht den Abgeordneten dabei als „Statusinhaber” und in seiner Stellung als Parlamentsmitglied ein öffentliches Amt. Ein Zitat von Peter Graf Kielmannsegg macht diese Perspektive deutlich: „Das Amtsprinzip kommt ohne das Konstrukt des hypothetischen Volkswillens aus. Die Pflicht dessen, der für alle entscheidet, die Belange aller zu bedenken, braucht nicht auf einen hypothetischen Volkswillen gegründet zu werden. Man wird also wohl sagen dürfen, dass, wer nicht von plebiszitärer und repräsentativer Komponente spricht, sondern von Amtsprinzip und Demokratieprinzip, die sich im demokratischen Verfassungsstaat verbinden, mit größerer Präzision und Klarheit formuliert.”6
Das wiederum würde bedeuten, die vielfältigen Bindungen des Abgeordneten genauer zu betrachten und zu schauen, wie diese schärfer zu fassen sind, um zu verhindern, dass aus Gewissensfreiheit (Art. 38 GG) eine Art verantwortungsfreie Verfügung über Dritte erwachsen kann.
Zwei Probleme erscheinen dabei: Erstens geben sich die Abgeordneten die Regeln, die Bedingungen ihres Amtes weitgehend selbst (wobei die Festsetzung der Diäten noch das geringste, aber populärste Übel ist). Das zu ändern wäre eine erstrangige Aufgabe für alle, die der Entartungs- oder Entfremdungsthese der Politik anhängen. Zweitens wäre das Verhältnis der Bürger zu Politikern produktiv zu fassen. Politik erschiene so als Verwaltungshandeln in einem sehr weiten Sinne, als eine Transformation von Macht in Recht zwischen Parlament, Behörden, Regierung – und Bevölkerung. Bürgerbeteiligung wäre gewissermaßen in Verfahren zu realisieren. Die anerkanntermaßen sinnvolle und notwendige Einbeziehung der Informationen, des Wissens der Betroffenen wäre zu realisieren. Legitimation von Entscheidungen durch Beteiligung wie Beachtung von Interessen wüchse, Verantwortung würde ausgedehnt.
Eine vierte Annahme ist die, dass es zweckmäßig wäre, Sachfragen gelegentlich unmittelbar, direkt, zu entscheiden. Der Wahlzyklus determiniert allzu oft bestimmte Sachentscheidungen parteipolitisch. Das ist zweifellos der Fall. Aber was folgt daraus? Einerseits funktioniert die parlamentarische Demokratie, der Aufstieg der LINKEN ist mit konkreten Sachentscheidungen der Regierung verbunden: Hartz IV, Rente mit 67, Afghanistan usw. Andererseits sollte zu diesem Mechanismus des Parteienwettbewerbs auch eine „grundsätzliche Alternative” möglich sein – von der Anstoßfunktion bis zur Volksgesetzgebung. Nicht abstrakt, sondern im jeweiligen konkreten Falle einer anstehenden Sachentscheidung. Es ginge also um bestmöglichen Wettbewerb zwischen Verfahren der direkten Demokratie und der repräsentativen Demokratie im jeweiligen Falle. Und die Betroffenen, die Bürger hätten jeweils zu entscheiden, welchen Weg sie von Fall zu Fall einschlagen wollen, für den besten halten.
Meine Absicht war es zu zeigen, dass die Forderung nach mehr direkter Demokratie eine richtige ist, man sich damit jedoch nicht so rasch der Notwendigkeit der Arbeit an der repräsentativen Demokratie entledigen sollte. Es geht eben um mehr Demokratie, da liegen in beidem die Chancen.
1 Ralph Kampwirth: Volksentscheide in Deutschland: Bayern Spitze, Berlin Schlusslicht. In: St. Brink & H. A. Wolff (Hrsg.): Gemeinwohl und Verantwortung, Berlin 2004, S. 368.
2 H. H. v. Arnim: Vom schönen Scheine der Demokratie, [Erscheinungsort?] 2001.
3 Die folgende Argumentation basiert auf einem konzeptionellen Rahmen, den Douglass C. North, John J. Wallis & Barry R. Weingast in ihrem Buch: Violance and Social Orders (Cambridge 2009) zur Interpretation der dokumentierten menschlichen Geschichte entwickelt haben.
4 S. Landshut: Der politische Begriff der Repräsentation. In: Ders., Politik, Bd. 1, Berlin 2004, S. 421ff.
5 Ich beziehe mich auf Albert Janssen: Mehr direkte Demokratie als Antwort auf den Niedergang des dt. Föderalismus? In: Gemeinwohl und Verantwortung, S.335 ff.
6 ebenda, S. 344