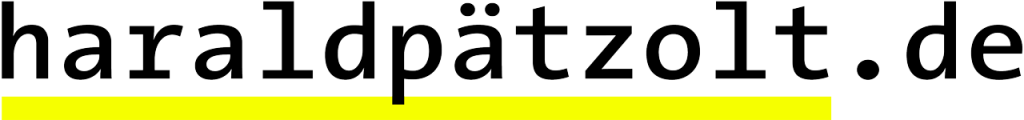(veröffentlicht in: Politische Berichte, Zeitschrift für linke Politik, Nr. 6 v. 3. Juni 2011, S. 22-24. )
I.
Entstanden ist die Die Linke als Reaktion auf die Agenda 2010. Die Agenda 2010 war die politische Bedingung für den letzten Akt (!) der Zerstörung der alten Ordnung der Produktion, Fordismus genannt. Diese Zerstörung war vom Kapital wegen der sich seit langem verschlechternden Verwertungsbedingungen (negative Skaleneffekte sinkender Ressourceneffizienz fressen positive Skaleneffekte der Massenproduktion, steigender Arbeitsproduktivität seit den 70er Jahren auf) erzwungen worden (statt Innovation und Produktivkräfte-Revolution Verschärfung der Ausbeutung).
Die Agenda 2010 setzte politisch an der alten Ordnung der Arbeit an und zerstörte diese final durch Etablierung eines breiten Niedriglohnsektors. Das Kapital setzte neoliberal auch an der Ordnung der Arbeit an und verhinderte, gemeinsam mit Gewerkschaften, ein Lohnwachstum in den Wachstumsbranchen. Das volkswirtschaftliche Grundprinzip der alten Ordnung der Produktion, aus dem Fordismus stammend: Beteiligung aller am wissenschaftlich-technischen Fortschritt, an Produktivitätsgewinnen, galt nun nicht mehr. Die Friseuse, in einer Branche ohne Produktivitätsentwicklung tätig, wurde ebenso wie der Autoverkäufer selbst, in einer Wachstumsbranche tätig, nun nicht mehr an den Fortschritten bei Volkswagen beteiligt.1
Gesellschaften wie die deutsche sind auf breite Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Diese Zustimmung basiert auf einem Set von Einstellungen, Grundüberzeugungen: erstens Gleichheit aller, zweitens ein fairer Anteil am Reichtum und drittens Integration in die Gesellschaft. Das Maß ist jeweils kulturell und historisch bestimmt, dessen Ausdruck ist das Empfinden sogenannter sozialer Gerechtigkeit. Die Agenda 2010 und die Zerstörung der Ordnung der Produktion, speziell der Ordnung der Arbeit, wurde in den Folgen zunächst massenhaft als sozial ungerecht antizipiert und dann, weniger massenhaft, eher milieu- und schichtenspezifisch, erlebt.
Die Linke skandalisierte diese Zerstörungen und deren Folgen als einzige Partei. Das war ihr Zweck und ihr Erfolgsgeheimnis von 2007 bis 2009. Der Inhalt ihrer Politik war im Kern die Wiederherstellung von sozialer Gerechtigkeit, von Gleichheit, Anteil am Reichtum und Integration. Man kann diese Politik gut restaurativ nennen, weil sie die Reaktion auf eine Negation war und sie war so doch vollkommen richtig. Das Neue, Revolutionäre, Innovative der linken Politik war diese Partei selbst, sie hat das Parteiensystem verändert. Der Slogan: „Für eine neue soziale Idee!“ war und ist in diesem Sinne widersprüchlich.
Die Schlacht ist seit 2009 verloren. Die alten Ordnungen der Produktion und der Arbeit sind unwiederbringlich zerstört. Unsere Truppen sind allerdings noch da, und sie sind stark. Die Linke ist heute nicht schwach. In Erinnerung der Dialektik könnte man sagen: Die Negation ist vollzogen, die von uns intendierte Negation der Negation steht noch aus. Heute, mitten im Krisengeschehen, sehen wir klarer, wo und mit wem die nächste Schlacht, die neue politische Auseinandersetzung, stattfinden wird: Die Krisenprozesse zwingen das Kapital zur Revolutionierung der Produktivkräfte, die weltweite Energie- und Ressourceneffizienzrevolution ist im Gange. In der Nahrungsmittelproduktion, im Energiebereich, in der Logistik, dem Verkehr, im Konsumgüterbereich, bei der Produktion von Produktionsmitteln. Wir als Linke sehen heute klarer als noch vor wenigen Jahren, dass es uns um eine solche Organisation, Ordnung der Produktion selbst, der materiellen und geistigen Produktion gehen muss, die Gleichheit, Anteil am Reichtum und Integration auf neuer technologischer Basis wiederherstellt. Es geht, kurz gesagt, um die Sozialisation, Vergesellschaftung des heutigen technischen Fortschritts, der Produktion selbst.2
Die erste Schlacht war eine gegen die SPD und ihre Nachfolger in Sachen Agenda 2010. Da jede neue Ordnung der Produktion, der Arbeit und damit der Gesellschaft wiederum auf breite Zustimmung angewiesen sein wird, ist ein politischer Wettbewerb der Parteien im Gange um Ausmaß und Umfang genannter Sozialisation. Die Position der Linken, Teilhabe im umfassenden Sinne, wäre dahingehend näher zu bestimmen.
II.
Sozialökologische Wende, soziale Energiewende – aktuell ist das in Deutschland „durch“, breiter Konsens. Vor diesem Hintergrund tobt ein knallharter Kampf der verschiedenen wirtschaftlichen Akteure um Anteile, Wege, Bedingungen, Kapital (Investitionen). Grob gezeichnet gibt es die vier Großen (Energiekonzerne), die großtechnologische Lösungen regenerativer Energieerzeugung favorisieren, Offshoreparks, die Sonne in der Sahara usw.. Sie versuchen alles an vorhandener, dezentraler Energieerzeugung zu schlucken und haben dies zu guten Teilen erreicht. Sie wollen Atomenergie und fossile Energien als sogen. Brückentechnologien langfristig nutzen. Entsprechend sehen die dafür angepeilten Netzlösungen aus. Auf der anderen Seite gibt es die klein- und mittelständischen Industrien von den Handwerkern bis Enercon, die Kommunen mit ihren Stadtwerken und die Genossenschaften, die Bürger.
Die politische Substanz dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, Entwicklungen, scheint wenig bestimmt. Mit einer Ausnahme: Die Großen tun das, was große Konzerne immer tun, sie machen, dass ihre Interessen als nationale Interessen erscheinen und so breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden. John Kenneth Galbraith hat das klassisch in seinem Buch „Wirtschaft für Staat und Gesellschaft“ (1973) beschrieben. Das ist aktuell der Kern der Debatte um die Energiewende: Die Sozialisierung der enormen Kosten derselben. Die Energieversorgung wird erstens als Wert an sich im nationalen Interesse (oft verbunden mit dem Verweis auf die Autoproduktion, die zu sichern sei) dargestellt (womit der Staat in die Pflicht genommen wird, also Steuergelder fließen und Steuern gespart werden sollen und entsprechende Gesetze die Verwertungsbedingungen garantieren. Zweitens wird mit der (scheinbaren) Selbstverständlichkeit massenmedial hantiert, dass der „neue“, der „gute“ Strom freilich was (extra) kostet (das klappt nicht immer gut, siehe E 10). Damit werden die Bürger doppelt, als Steuerzahler und als Konsumenten, zur Kasse gebeten. Es gibt ihn schon lange, den energetisch-industriellen Komplex, er wird nun grün.
Entsprechend haben die Kleinen, etwa Energiegenossenschaften, mit Investitionsproblemen zu kämpfen, die Staat (Länder und Kommunen) und Banken gemeinsam erst schaffen, wenn sie etwa revolvierende Fonds nur zurückhaltend behandeln. Und, das darf dabei nicht übersehen werden, wird damit der übrige, nicht unmittelbar vom Energiekartell beherrschte Bereich der Öko- und Energiewirtschaft in einer Ordnung der Produktion und Arbeit zu bleiben gezwungen, die alles andere als progressiv und sozial ist. Selbstausbeutung, untertarifliche Bezahlung prägen die Arbeitsverhältnisse bei den Kleinen der Branchen. Kurz: der soziale Inhalt dieser Auseinandersetzungen ist ein umfassender, das geht weit über die Frage des bezahlbaren Stroms für Unterprivilegierte hinaus.
III.
Wir als Linke müssten also erstens den Energetisch-Industriellen Komplex entschieden bekämpfen. Wir müssten zweitens die anderen Wirtschaftsformen klar stärken. Und wir müssten drittens die Arbeitnehmer in allen (!) Bereichen, was ihre Arbeitsverhältnisse betrifft, stärken. Endlich sind wir viertens dazu verpflichtet, uns um die alten (Globalisierungs- und Krisenverlierer) und neuen (Energiewendeverlierer) zu kümmern. Wenn wir dies vor dem Hintergrund der oben genannten Grundüberzeugungen (Gleichheit, Anteil/Teilhabe und Integration) verstehen, dann wird es keine verengte Form des Engagements geben, dann geht es in diesem Kontext der Energiewende wie gehabt auch um Bildung, um Soziale Sicherungssysteme, Wohnen usw. usf.
IV.
Eines wäre noch anzufügen. Die Sache findet in einer globalisierten Welt und in einem globalisierten Deutschland statt. Das bedeutet einen rücksichtslosen Standortwettbewerb. Die Rückkehr des Nationalstaates ins politische Denken der Kanzlerin Merkel erklärt sich vor dem Hintergrund, dass Deutschland und einige wenige erfolgreiche Staaten (USA, China,…) ihre Strategien international durchsetzen wollen. Diese Strategien differieren, haben aber das miteinander gemein, dass sie Strategien der Externalisierung ihrer Probleme und der Kontrolle der (globalen) Nachbarn sind. Sie tun das erstens durch aggressive Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik sowie zweitens durch militärisches Engagement. Und drittens darf eine subtile Form der Externalisierung nicht vergessen werden, die Exklusion der Überflüssigen innerhalb der eigenen Grenzen. Das zeigt sich besonders deutlich in der aktuellen Krise (Kürzel für sehr komplexe Umbrüche).
Was daraus folgt ist, dass diese Gesellschaften, Mehrheitsgesellschaften, als Beutegemeinschaften erscheinen und auftreten. Man hat am Wohlstandsgefälle ein kollektives Interesse, entwickelt entsprechende Ängste in Krisenzeiten. Das ist gewissermaßen Stufe zwei der sozialen Konstruktion eines nationalen Interesses. Und nicht nur die Regierungen generieren Gefolgschaft, sondern Regierung und maßgebliche Teile der parlamentarischen Opposition sorgen für Akzeptanz dieser Strategie.
Dagegen kann und muss eine Linke eine neue Strategie setzen. Eine Strategie solidarischer globaler Nachbarschaft. Einer Nachbarschaft, die sozialer, ökologischer, demokratischer, wirtschaftlicher und friedlicher Natur wäre.
V.
Soweit, so gut. Nun ist die Partei so, wie sie ist. Und der Parteienwettbewerb ist es auch. Aber wie ist er denn für uns?
Kurz gefasst, scheint für 2013 der Linken keine Machtperspektive zu erblühen. Daher gibt es nur schwache Anreize zu politischer Erneuerung, zur Entwicklung und Präsentation neuer, innovativer Lösungen für grundlegende gesellschaftliche Probleme. Andererseits droht ein Bedeutungsverlust. Und ausgerechnet heute soll sich die Partei ein neues Programm geben. Dabei hat der innerparteiliche Suchprozess nach neuen Lösungen, dem damit verbundenen eigenen Platz vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft in einer sich rasant verändernden Welt doch gerade erst, schwach, ganz schwach noch, begonnen. Das aber wären die Aufgaben der Zeit: erstens Teilhabe an all den oben beschriebenen realen Auseinandersetzungen, vor Ort und in Parlamenten, in beiden Arenen. Zweitens ein breiter, solidarischer, freundlicher, öffentlicher Wettbewerb in der Partei um Konzepte, Lösungen, Durchsetzungsstrategien usw. Und drittens eine Führung, die nur eines im Sinn hat und dies auch kann: Beide Prozesse machtpolitisch ganz unambitioniert organisieren.