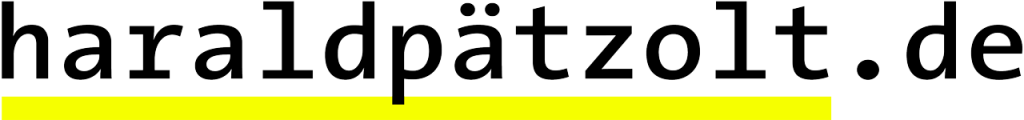(Veröffentlicht in: Elternaus und Schule, Heft 10/1985, S. 12 – 13. Koautorin: Dr. Ilona Salz)
Uns mit anderen Menschen verständigen und in sinnvoller Abstimmung mit ihnen zusammenwirken, das ist eine wichtige Grundlage unseres täglichen Lebens. Wenn wir damit einmal Probleme haben, denken wir mitunter wehmütig an die scheinbare Leichtigkeit, mit der Kinder ihre zwischenmenschlichen Beziehungen regeln können. Wie sich Gemeinsamkeit im Spiel herstellt wie Kinder lernen, miteinander umzugehen – darüber schreiben Dr. Ilona Salz und Dr. Harald Pätzolt.
Miteinander spielende Kinder treffen wir überall – auf dem Spielplatz, im Park, auf den Wiesen. Wie stark beeindruckend sind ihre Geselligkeit und Ausgelassenheit! Doch der erste Blick trügt hier. Nehmen wir uns einmal die Zeit, beobachten wir einige Kinder auf dem Spielplatz. Was geschieht an der Rutsche nicht alles in nur zehn Minuten! Einträchtiges Miteinander wechselt mit heftigem Streit, manchmal fließen auch Tränen. Und nebenan spielt die ganze Zeit ein Kind allein. Das kleine Mädchen »traut« sich nicht zu der Gruppe »Plumpsack« spielender Kinder. Und ein Junge kommt einfach nicht dran auf der Schaukel. Es ist also auch für Kinder nicht so einfach, zu produktiver Gemeinsamkeit zu kommen. Da müssen Absichten koordiniert und Meinungen ausgetauscht werden, Vorgehensweisen sind miteinander abzustimmen. Nicht selten müssen eigene Wünsche zurückgestellt werden. Die anderen verstehen können und sich selbst verständlich machen, das sind auch für das Kind schwierige Aufgaben. Der Prozeß des Erwerbs dieser und anderer ähnlicher Fähigkeiten, den man als soziales Lernen bezeichnet, ist nicht weniger kompliziert als andere Lernprozesse. Die Regeln des Umgangs miteinander lassen sich dabei kaum theoretisch aneignen, sondern nur durch die Erfahrung in der eigenen, möglichst vielfältigen Tätigkeit mit anderen.
Was ein spielendes Kind beachten muß
Das Spiel, die Haupttätigkeit der jüngeren Kinder, ist ihr wichtigstes Feld für die Aneignung sozialer Erfahrungen, denn es bietet wie kaum eine andere Tätigkeit Möglichkeiten dafür. Besonders im Rollenspiel kommt ein so vielfältiges Geflecht sozialer Anforderungen zusammen, daß man sich wundert, wie das Kind dies überschaut und beherrscht. Es schlüpft innerhalb kurzer Zeit in unterschiedliche Rollen und spiegelt dabei in seinem Verhalten typische Eigenschaften, Tätigkeitsmerkmale und Beziehungen der dargestellten Personen wider. Da das Rollenspiel häufig mit anderen Kindern gemeinsam gespielt wird, geht das Kind gleichzeitig Beziehungen zu den Mitspielern ein, die komplizierter sind, als man auf den ersten Blick vermutet. Es verhält sich in der Rolle zu ihnen -zum Beispiel als »Mutter«, die ihre »Kinder« belehrt. Gleichzeitig bleibt es sich aber der Spielsituation bewußt und kann jederzeit aus ihr heraustreten, um von Spielpartner zu Spielpartner Absprachen zu treffen.
Es ist faszinierend, wie mühelos dieser Wechsel gelingt. Eben noch ermahnende Mutter – dabei Gestik, Mimik und Tonfall trefflich nachahmend -, ist Kerstin angesichts der ungehorsamen Kinder von einem Augenblick zum anderen entrüstete Mitspielerin und fordert energisch die Einhaltung der getroffenen Spielübereinkunft, also die Wahrung ihrer mütterlichen Autorität. Und da die Kinder Einsicht zeigen, fällt sie sofort wieder in die spielerische Tonart zurück.
So hat das Kind ständig mehrere Dinge gleichzeitig zu beachten: Da sind einmal die Anforderungen der Rolle (Was tut eine Mutter so alles?) und die Beziehungen in der Rolle zum Partner (Wie ist die Mutter zu ihren Kindern?). Weiterhin gibt es Beziehungen zu Spielpartnern (Wie spiele ich meine Rolle so, daß alle Spaß am Spiel haben?) und Anforderungen der Spielsituation, die durch äußere Faktoren bedingt sind (Wie laut darf man sein? Wie weit darf man sich entfernen?). Das Kind hat also eine Vorstellung von dem, was es spielt (Rolle). Wie es mit all diesen Anforderungen zurecht kommt, kennzeichnet sein erreichtes soziales Niveau.
Wie man ein guter Mitspieler wird
Die Themen der Rollenspiele unserer Kinder sind so vielfältig wie das Leben selbst. Alles was sie interessiert und begeistert, aber auch das, was ihnen mißfällt und sie bedrückt, wird spielerisch von ihnen aufgegriffen. Je intensiver etwas erlebt wurde, desto stärker der Drang, es im Spiel nachzugestalten. Mit dem Heranwachsen des Kindes ändern sich natürlich sein Erlebnisbereich und damit seine Interessen. Die Spielthemen wechseln. Auch in der Gestaltung von Rollen gibt es typische Entwicklungsverläufe. Jüngere Kinder (Zwei- bis Dreijährige) konzentrieren sich vor allem auf äußere Tätigkeitsabläufe, die leicht zu durchschauen sind. Sie ziehen ihre Puppen an und aus, füttern sie oder legen sie schlafen. Mitunter erfährt eine Puppe dabei recht unsanfte Behandlung, da das kleine Kind noch nicht bewußt darauf aus ist, eine Mutter-Kind-Beziehung darzustellen. Die meisten Rollen werden in diesem Älter auf wenige markante Tätigkeiten reduziert. Bei einem Arztbesuch etwa interessiert besonders das Spritzen, und so wird es nun als hervorstechende Tätigkeit im Spiel mit den Puppen und Teddys endlos wiederholt.
Um das dritte Lebensjahr herum wird das Verhalten des Kindes in der Rolle differenzierter. Es führt nun nicht mehr nur einzelne Tätigkeiten an der Puppe aus, sondern bringt durch behutsames Aufnehmen, Streicheln und Zureden eine Beziehung zu ihr zum Ausdruck – eben die liebevolle Beziehung der Mutter zum Kind. Beim- Füttern, – Ausziehen, Baden- und Hinlegen beginnt es, auf die korrekte Reihenfolge zu achten. Ebenso wird nun die Beziehung des Arztes zum Patienten differenzierter dargestellt, mit Befragen, Trösten und Behandeln. Das Kind weitet die Rollen immer mehr aus, entdeckt und spielt schließlich auch die Beziehungen der von ihm dargestellten Person zu weiteren Personen. Es spielt die Mutter, die mit dem Kind einkaufen geht, es in den Kindergarten bringt oder dem Arzt vorstellt. Wieviel Verständnis von uns und unserer Welt zeigt sich doch darin!
Spielen mehrere Kinder gemeinsam, so stellt sich die Frage der Rollenverteilung. In fast allen Spielen gibt es gefragte und weniger gefragte Rollen. Die meisten Kinder wollen Personen verkörpern, die sie als besonders fähig und angesehen empfinden und von deren interessanten Tätigkeiten sie sich angeregt fühlen. Sie möchten also lieber Mutter, Arzt oder Krankenschwester sein, die Rollen des Kindes oder Patienten sind nicht so begehrt. So beginnt manches Spiel mit heißen Wortgefechten um die Rollenverteilung. Wer einen begehrten Part erhält, der hat einen ersten sozialen Erfolg errungen. Doch im Spiel selbst erlebt er bald, daß dieser mit neuen Anforderungen verbunden ist. Wer eine zentrale Rolle in einem Spiel bekleidet, hat wesentlichen Anteil am und auch Verantwortung für zügigen und interessanten Fortgang. Diesen Anspruch können nur Kinder erfüllen, die bereits fundiertes Wissen über die Tätigkeiten und Verhaltensmöglichkeiten der Personen haben, die sie gerade verkörpern, und es auch umsetzen können. Dadurch wirken sie anregend auf den Spielverlauf und auf andere Kinder. Sie haben gute Chancen, auch zukünftig wieder in attraktive Rollen gewählt zu werden.
Manuela ist eine allgemein anerkannte »Mutter«, unter deren Leitung andere gern die Kinderrolle übernehmen. Sie arrangiert Geburtstagsfeiern mit allerlei Überraschungen, besucht mit ihren »Kindern« einen imaginären Zoo und macht mit ihnen einen Wochenendausflug mit Picknick im Freiem. Woher hat sie diese Fähigkeiten? Manuela schöpft dabei aus Erfahrungen, die sie gemeinsam mit ihren Eltern machte und nun spielerisch nacherlebt. Starke positive Erlebnisse sind die wichtigste Quelle kindlicher Spiele. Sei es ein Zirkusbesuch, eine Reise oder auch eine schöne Geschichte – sie regen Kinder zum Nachgestalten und Nachempfinden an. Kinder mit eingeschränktem Erlebnisbereich haben es da schwerer, etwas Neues zum gemeinsamen Spiel beizutragen. Sie müssen öfter als andere die Erfahrung machen, seltener in attraktive Rollen gewählt zu werden oder diese nicht zufriedenstellend ausfüllen zu können.
Daher ist es wichtig für uns zu wissen, was und wie unser Kind mit anderen spielt, um ihm gegebenenfalls neue Anregungen zu geben, die seine Position in der Spielgruppe verbessern. Versuchen Sie ruhig einmal, mehr von Ihrer Kindergärtnerin zu erfahren, als daß Ihr Kind immer »schön gespielt« hat.
Übrigens: Je besser ein Kind weiß, »was es kann«, je mehr Anerkennung es finde Spielgruppe erfährt, desto bereitwilliger ordnet es sich auch beim nächsten Spiel ein, in dem es nicht führt. Gute Spieler sind auch unter Kindern stets gute Mitspieler!
Von Schwierigkeiten und dem Wert des Miteinander
Nicht nur bei der Rollengestaltung lassen sich Entwicklungsverläufe feststellen, auch die Fähigkeit zur Gemeinsamkeit im Spiel wird erworben. Kleinkinder spielen eher nebeneinander als miteinander. Dennoch brauchen auch sie schon den Partner. Allein die Anwesenheit des anderen Kindes, die Möglichkeit, ab und zu hinüberzuschauen, vermittelt Gefühle der Geborgenheit und Anregungen. Bei jüngeren Vorschulkindern ist die Gemeinsamkeit meist durch einen gemeinsamen Spielgegenstand vermittelt. Da werden Bausteine ausgetauscht, oder ein Ball wird zwischen den Partnern hin und her gerollt. Ältere schließlich planen ihre spiele bereits recht vollständig, indem sie Rollen und Abläufe vorher festlegen. Gewisse Variationen sind dabei erlaubt. Das ermöglicht unterschiedliche Spielverläufe, läßt keine Langeweile aufkommen und nötigt den Spielpartnern echte Leistungen ab.
So kann es für die »Mutter« recht anstrengend sein, ihre unfolgsamen »Kinder« zu bändigen, und es bedarf einiger Einfälle ihrerseits. Gelingt die Aktion, verläuft das Spiel erfolgreich. Was geschieht aber, wenn ein Partner seine Rolle überzieht oder ganz aus der Rolle fällt? Wenn die »Kinder« der »Mutter« absolut nicht mehr gehorchen oder der »Patient« die Instrumente des »Arztes« eigenmächtig gebraucht? In so einem Fall scheitert das Spiel, die Handlungen lassen sich nicht mehr koordinieren. Die Kinder, die sich an die Regeln gehalten haben, reagieren auf die »Störer« mit Recht unwillig. Doch selbst das nunmehr gestörte Spiel vermittelt noch eine soziale Erfahrung: Ohne Einhaltung bestimmter Grundregeln, ohne eine gewisse Anpassung aneinander geht es nicht. Da kindlicher Zank oft nicht lange anhält, einigt man sich bald auf ein neues Spiel – diesmal mit mehr gegenseitiger Rücksicht und somit auch größerer Aussicht auf Erfolg.
Der Erwachsene sollte nur dann eingreifen, wenn wegen Mangel an Einsicht kein neues Spiel gelingen will. Kindliche Auseinandersetzungen sind erst einmal nicht unbedingt ein Grund zum Intervenieren. Auch Streiten will gelernt sein! Die Einsicht, daß mit einem Abbruch des Spiels keinem gedient ist, stellt sich bei den meisten Kindern von selbst ein. Mit der zunehmenden Lust, wieder mit den anderen zu spielen, wächst auch die Bereitschaft, sich zu einigen. Da kann man ruhig mit Vorschlägen helfen.
Das Spielverhalten des Kindes hängt auch stark von den Erwartungen der Erwachsenen ab, die sie ihm direkt durch Lob und Kritik oder indirekt durch ihr Verhalten mitteilen. Da diese Erwartungen unterschiedlich sein können, passen sich Kinder schnell der entsprechenden Situation an, spielen zum Beispiel im Kindergarten anders als zu Hause oder auf dem Spielplatz. Auch das ist soziales Lernen. Kritisch wird es nur, wenn Eltern zeigen, daß Spiel für sie unwichtig, nur ein Zeitvertreib ist. Kinder sind stolz auf ihre Erfolge im Spiel. Wenn Stefan glücklich erzählt, daß er heute der Indianerhäuptling sein durfte, sollte man seine Freude ruhig teilen und nicht mit einem: »Wasch dich lieber erst mal richtig, das ist wichtiger!« reagieren. Erleben Kinder häufig, wie ihr Spiel und ihre Spielgruppe abgewertet werden, so können sie auch selbst eine destruktive Einstellung zum Spiel entwickeln und ein gestörtes Spielverhalten zeigen. Damit verringert sich aber das Feld der sozialen Erfahrungen für diese Kinder erheblich, sie haben es im Umgang mit anderen oft schwerer.
Manche Eltern wundem sich, daß ihre »braven« Kinder sich im Spiel in die Rollen der besonders Frechen und Wilden drängen. Dabei kompensieren sie auf diese Art doch ihr unbefriedigtes Bedürfnis alles Erlebte nachspielend auszuprobieren. Bei diesen Eltern nimmt das Spiel ihrer Kinder vielleicht einen zu geringen Platz im Familienalltag ein.
Wenn wir das Spiel als wichtige Tätigkeit des Kindes anerkennen, dann müssen wir das Kind auch in dieser Tätigkeit achten und fördern. Es erschließt sich dadurch Erfahrungsbereiche, die weit über das »Spielalter« hinaus sein Leben beeinflussen.