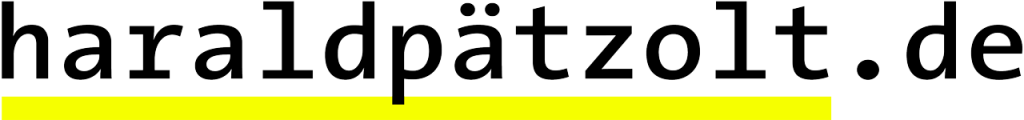(veröffentlicht in: Elternhaus und Schule 3/90, S. 12 – 13)
Alle demokratischen Kräfte in der DDR sind sich heute weitgehend darin einig, daß ein modernes Gemeinwesen nur eine Perspektive hat, wenn es leistungsorientiert, ökologisch und sozial ist, wenn es Wettbewerb und Kooperation fördert, auf Solidarität und Individualität der in ihm lebenden Menschen beruht. Es kann daher angenommen werden, daß diese Charakteristika auch und gerade der Schule zukommen müssen, die die Kinder und Jugendlichen auf dieses Gemeinwesen hin bilden und erziehen soll.
Freilich werden die genannten Begriffe von den verschiedenen politischen Kräften im Lande verschieden interpretiert, und die Differenzen berühren heute immer stärker auch die bildungspolitischen Auseinandersetzungen. Dagegen haben Kinder und Erwachsene in letzter Zelt gefordert, daß dieser notwendige Parteienstreit nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden darf.
Dr. Harald Pätzolt scheint es geboten, einige kritische Fragen an unsere Schule aus demokratischem Grundverständnis heraus zu stellen.
Allgemein wird immer klarer, daß unsere Schule, dem alten Grundsatz “Nicht für die Schule, sondern für das Leben!” verpflichtet, die Kinder eben nicht in die Lage versetzte, den Aufgaben der Zeit verantwortungsbewußt und gebildet entgegentreten zu können. Schule ist immer noch das irdische Jammertal, das es zu durchschreiten gilt, um zum jenseitigen Erwachsenenleben zu gelangen, welches Lohn für alle Mühen verspricht.
Das Leistungsprinzip kann für die Schule folgendermaßen formuliert werden: Jeder Schüler soll nach seinen individuellen Lernfähigkeiten lernen können, und jeder Schüler soll entsprechend seiner individuellen Lernleistung bewertet werden.
In diesem Sinne ist unsere Schule nicht leistungsorientiert. Die Schüler einer Klasse werden im Grunde mit Anforderungen konfrontiert, die aus einer angenommenen durchschnittlichen Lernfähigkeit und einem durchschnittlichen Leistungsvermögen abgeleitet wurden. Gleiche Anforderungen für alle heißt die Maxime. Von dieser Maxime kann durch differenzierte Unterrichtsgestaltung höchstens abgewichen werden.
Wie auf der Anforderungsseite, wird auch auf der Bewertungsseite gegen das Leistungsprinzip verstoßen. Gleiche Anforderungen für alle bei ungleichen Leistungsvoraussetzungen und gleicher Maßstab der Bewertung – das bedeutet ungleiche Behandlung der einzelnen Schüler bei der Zensierung.
Ein weiteres Problem, das dem Leistungsprinzip entgegensteht, ist folgendes: Jahr für Jahr bewegen sich die Schüler zwischen den Noten 1 bis 5. Ein- Schüler kann zehn Jahre lang in Mathematik die Note 3 bekommen. Das heißt, für ihn wird nie erkennbar, welchen Entwicklungsstand er jeweils, bezogen auf das Endniveau Klasse 10 etwa, erreicht hat. Das Absurde dieses Verfahrens wird deutlich, wenn man einmal annehmen würde, dies gelte auch für die Werktätigen. Dann hätte ein Ungelernter die Möglichkeit, zwischen 500 und 1 000 Mark zu verdienen, ein Facharbeiter ebenso, Menschen mit Fach- und Hochschulabschlüssen auch.
In der Schule sind überwiegend spezielle Fähigkeiten und Leistungen gefragt. Das muß auch so sein. Aber: Leistungsorientiert ist in speziellen Bereichen der Schüler doch nur, wenn ihn entweder die Sache selbst interessiert oder wenn er ein für ihn attraktives Äquivalent für seine Leistungen bekommt. Warum soll sich ein Schüler in einem Fach, welches ihn nicht interessiert, anstrengen? Motivation zielt immer auf den ganzen Schüler, nicht auf ein Teil von ihm, das gerade eine Mathematik-Aufgabe löst.
Ein Schüler erlangt durch seine Lernleistung keineswegs soziale Anerkennung in der Schule als sozialer Organisation. Höchstens in der eigenen Klasse, kaum in der Klassenstufe, gar nicht über die Klassenstufen hinweg. Denn zum einen ist für das Sozialprestige des einzelnen die bloße Zugehörigkeit zu einer höheren Klasse wichtiger als die Schulleistung. (Schüler X mag noch so ein As in Physik sein; der durchschnittliche Schüler Y wird, weil eine Klasse höher, ihm sozial immer überlegen sein.) Zum anderen ist heute gar kein Vergleich der Leistungen einzelner über die Klassenstufen hinweg möglich. So kann es zu keiner Anerkennung außerhalb der eigenen Klasse kommen.
Das Prinzip der sozialen Orientierung der Schule könnte so formuliert werden: Die Entwicklung der/ des einzelnen darf nicht auf Kosten der/des anderen gehen. Und:
Die Entwicklung der/des einzelnen Schüler(s) ist Voraussetzung für die Entwicklung aller Schüler. Dieses Prinzip wird nicht realisiert. Vielmehr ist unsere Schule einem Prinzip verpflichtet, wonach die Entwicklung der Schüler weitgehend parallel und unabhängig voneinander erfolgt. Die sogenannten Leistungsstarken werden in ihrer Entwicklung gehemmt und produzieren permanent Gefühle der Unterforderung. Die sogenannten Leistungsschwachen hemmen die anderen und produzieren Gefühle der Überforderung. Das Tempo wird vom Mittelmaß bestimmt – auf Kosten der Schwachen wie der Starken. Und die Mittelmäßigen schaden sich selbst, indem sie die Möglichkeiten der Kooperation und Arbeitsteilung im Lernprozeß mit Schwächeren und Stärkeren nicht nutzen.
Dazu kommt, daß wohl jeder Schüler irgendwann begriffen hat, es ist für die Schule vollkommen gleich, ob er eine 1 oder eine 3 als Jahresendnote hat – vorausgesetzt, die Statistik stimmt. Das heißt, seine eigene Entwicklung ist keineswegs Voraussetzung für die Entwicklung anderer. Andererseits kann man kaum behaupten, daß Konkurrenz und äußerer Leistungsdruck ein Markenzeichen unserer Schule seien.
Lehrstelle oder Studienplatz waren sicher; und die Unterschiede in der Attraktivität der einzelnen angezielten Karrieren sind nicht sehr groß. Die Schule hätte daher auch keine Chance gehabt, Konkurrenzdruck zur Leistungssteigerung zu nutzen. Darüber hinaus ließ die soziale Behaglichkeit unserer kleinen Welt kooperatives Lernen nicht als notwendig erscheinen. Kooperation erfordert zunächst Aufwand, und der lohnte sich nicht. Jedermann weiß um die Vergeblichkeit von Lernpatenschaften oder Lerngruppen als dauerhafte Einrichtungen im Schulalltag. Sie klappen höchstens vor Prüfungen als Repetierzirkel der Mittelmäßigen.
Dieses Prinzip fordert die Schulumwelt als gestaltet und gestaltbar nach menschlichen Maßen. Fragen der funktionellen Gestaltung der Schulumwelt (Klassenräume, Turnhallen, Flure, WC und so weiter), bezogen auf einen bestimmten vorgegebenen Typ des Unterrichtens (nicht des Lernens!), sind wohl wichtig, aber nicht die entscheidende Frage. Gleiches gilt für Probleme der Gestaltung der physischen Bedingungen der Schüler und Lehrer (Raumgröße, Möbel, Licht, Temperatur und so weiter). Alle Veränderungen auf diesen Gebieten bleiben wenig wirkungsvoll, wenn Schulumwelt nicht begriffen wird als Raum, der Möglichkeiten für den sozialen Verkehr von Schülern und Lehrern bieten muß. Schulumwelt Ist heute kritisch daraufhin zu betrachten, welche Möglichkeiten der fortwährenden Gestaltbarkeit durch die Nutzer und der Selbstdarstellung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sie bietet. Diesbezüglich sieht unsere Bilanz traurig aus. Schulumwelten sind nur sehr grob Altersbesonderheiten angepaßt. Gerade die Unterstufe hat spezielle Bedingungen, der Rest wird gleich behandelt. Geschlechtsdifferenzen finden in der Schule keinen Raum – Schüler sind geschlechtslose Wesen.
Sie haben kaum Möglichkeiten, ihre eigene Umwelt in der Schule zu gestalten. Schüler sind Gäste, nicht Bewohner ihrer Schule. Entscheidend aber ist: Das strenge Raum- und Zeitregime des Schulalltags verhindert nahezu perfekt die Begegnung der Schüler während ihrer Haupttätigkeit, des Lernens, außerhalb der Klassen. Bevor einer nicht in der sechsten Klasse ist, wird er nicht erfahren, wie es dort zugeht. Schule bietet weder Raum noch Zeit für den Verkehr, den Umgang der Schüler miteinander in kleinen Gruppen oder größeren Verbänden. Man kennt sich untereinander kaum, bis dann die Neugier fürs andere Geschlecht einige Barrieren durchbricht.
Auf die Konsequenzen für die Leistungsorientierung und die soziale Orientierung, die aus dem Mangel an sozialem Verkehr miteinander folgen, habe ich bereits hingewiesen.
Endlich ist ein wesentlicher Punkt der, daß die Schulen, zumindest in den Städten, Nischen bilden in den Kommunen, vom kommunalen Leben weitgehend isoliert sind. Die Möglichkeiten der Nutzung der Schulen durch die Kommunen sind sehr begrenzt, und dies ist durchaus nicht ohne Bedacht so inszeniert: Drinnen wird gelernt und erzogen, draußen wartet das Leben.
Das Prinzip der Solidarität meint zum einen die unbedingte Hilfe für Schwächere, zum anderen die Erwartung, daß der Schwächere das seine tut. Solidarität setzt die Anerkennung der Würde des einzelnen voraus und über alle anderen Maßstäbe.
Beide Aspekte der Solidarität sind in unserer Schule weder im Lern- und Leistungsbereich noch im Bereich des sozialen Verkehrs im weiteren Sinne zu realisieren. Schon einfache Formen kooperativen Lernens sind kaum erkennbar. Alle Formen des Lernens, die das vorhandene Wissensgefälle nutzen könnten, sind nur rudimentär entwickelt. (Man stelle sich nur einmal vor, wieviel Wissen bei den Schülern einer Schule angehäuft ist und wie ungleich es naturgemäß verteilt ist!) Im streng gegliederten sozialen System Schule, worin die einzelnen Klassen weitgehend autonom sind, kaum horizontale Vernetzungen (zwischen Parallelklassen) oder vertikale Vernetzungen (zwischen Klassenstufen) existieren, gibt es sozialen Austausch nicht. Man kennt sich nicht, hat weder Raum noch Zeit füreinander. Selbst auf Klassenebene, wo, wie beschrieben, die Stärken und Schwächen der einzelnen nicht systematisch genutzt, sondern eher nivelliert werden, bleibt Solidarität die Ausnahme.
Dazu kommt, daß Schüler und Lehrer einander fast ausschließlich in bestimmten Rollen begegnen, nicht als Individuen mit eigener Persönlichkeit. Für den Fachlehrer sitzt da ein mehr oder weniger lernwilliger und leistungsfähiger Schüler seines Faches, für den Schüler steht dort der Lehrer X, nicht der Mensch X. Die Fähigkeit, sich selbst und die Schüler im Unterricht realistisch wahrzunehmen und einzuschätzen, ist bei den meisten Lehrern zu gering ausgebildet.
Ein Gradmesser dafür ist auch: Wie viele Schwächen darf ein Lehrer haben und zeigen, für die er nicht nur Toleranz, sondern auch Solidarität von seinen Schülern erwarten kann?
Das Prinzip der Individualität meint, daß in der Schule die Entwicklung des einzelnen in seiner Ganzheit vor der Entwicklung einzelner Seiten aller steht.
Genau das Gegenteil ist überwiegend die Praxis.
Entwicklung und Anerkennung von Individualität setzt einen reichen sozialen Verkehr miteinander voraus, setzt voraus, daß das eigene Tun, die eigene Entwicklung für die anderen bedeutsam ist und umgekehrt.
Die Isolation der Schule von der Umwelt macht, daß das Kind X in der Schule zum Schüler X wird und nur als solcher behandelt wird. Endlich macht die Art und Weise des Unterrichts, daß der einzelne die Summe der Leistungen und Noten übers Jahr und über alle Fächer wird – plus »Gesamtverhalten. Ein geschlechtsloses Wesen, dessen sonstige (»außerschulischen«!) Leistungen und Bedürfnisse, soweit nicht »gesellschaftlich bedeutsam”, zu vernachlässigen sind. Der einzelne hinterläßt in der Schule kaum Spuren. An jedem Arbeitsplatz finden sich mehr persönliche Dinge als am Platz eines Schülers. Und wie lange ist es eigentlich her, daß Formen des Selbstausdrucks wie Kleidung, Frisur und so weiter vor massiver Unterdrückung befreit wurden?
Das ist die Lage, im Prinzip freilich. Und daß alle Aspekte so miteinander zusammenhängen, deutet darauf hin, daß hier Strukturen wirken, denen Lehrer, Eltern und Schüler in ihrem Bemühen, das Beste daraus zu machen, letzten Endes ohnmächtig gegenüberstehen. Darauf muß eine radikale Schulreform eine Antwort finden.