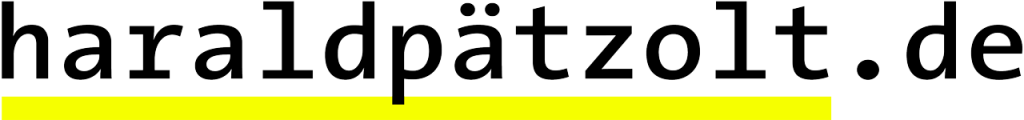(Impulspapier für die Klausur der Linksfraktion im Deutschen Bundestag am 13. und 14. Januar 2012 von Olaf Miemiec, Harald Pätzolt)
Dieser Text erfüllt keinen anderen Zweck, als eine Diskussion auf der Fraktionsklausur darüber anzuregen, wie die Fraktion zur Stärkung der politischen Attraktivität der LINKEN beitragen kann. Wenn einige Behauptungen nicht geteilt werden sollten – umso besser.
I. Die Eigenständigkeit stärken
Die „privilegierte Partnerschaft“ Rot-Grün ist reine Propaganda. Es gibt ein linkes Lager insofern, als dass SPD, Grüne, DIE LINKE und neuerdings die Piratenpartei in einem sehr weiten Sinn linken Wählerfeld miteinander konkurrieren. Aber das findet keine Widerspiegelung in einem linken Projekt. Die SPD hat sich auf ihrem jüngsten Parteitag explizit gegen den Begriff „Projekt“ gewandt, sie hat in den vorangegangenen Landtagswahlen Koalitionen aus rein machttaktischen Kalkülen heraus gebildet, auch wenn der Preis der ist, im Bundesrat nicht die Stärke zu haben, die sie haben könnte.
Mit dem Auftreten der Piraten verstärkt sich das Ganze. In den Umfragen hat Rot-Grün keine bundespolitische Mehrheit (vorausgesetzt, es wären gerade Bundestagswahlen). Die CDU versucht ideologische Lockerungsübungen in Richtung SPD, die SPD wird sie wohl verstehen. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit für eine Große Koalition wächst.
In einer solchen Situation ist eine politische Strategie, die mit möglichen Bündnisoptionen rechnet, nicht zu empfehlen. Wenn es zu einem rot-grünen Projekt schon nicht reicht, müssen wir uns keine Illusionen machen. Vielmehr ist der Oppositionskurs deutlich zu machen und großen Wert auf die Eigenart der LINKEN zu legen.
Allerdings wäre das, strategisch gesehen, auch nur die halbe Wahrheit. Wenn die Wählerschaft (nicht nur die eigene) uns im linken Lager verortet (und das ist der Fall), dann ist es für diese verstörend, eine solche Zugehörigkeit zu leugnen. Anders als in den Zentralen der SPD oder der Grünen erwarten die Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Lager eine gewisse Bereitschaft und Fähigkeit zu kooperativem Verhalten. Verweigern SPD und Grüne dies, mindert es für die eher links verorteten Wählerinnen und Wähler die Wahrscheinlichkeit derartiger Koalitionen, wenn DIE LINKE dies zudem verweigert, wird sie mangels jedweder anderen Option, für viele unwählbar.
Sowohl der Parteitag der Grünen als auch der SPD-Parteitag haben eines verdeutlicht, was mit einem Beispiel illustriert werden kann. Nicht der Streit, um wie viel Prozent der Spitzensteuersatz steigen soll ist interessant, denn er soll ja laut Beschlusslage steigen. Wichtig ist, dass der Grundtenor der war: Ja, wir wollen soziale Gerechtigkeit, ja, wir wollen Umverteilung auch von oben nach unten, aber wir machen das nur, wenn die Wirtschaft das genehmigt. Wir können die Abgrenzung hier gut vornehmen, da wir soziale Gerechtigkeit nicht an Bedingungen derart knüpfen, dass ein paar Unternehmer das erlauben.
Der zu verallgemeinernde Punkt ist hierbei der folgende: DIE LINKE muss politisch den Zielkonflikt suchen (Gleichheit vs. Ungleichheit, Inklusion vs. Exklusion, Wohlstand vs. Armut, Freiheit vs. Unfreiheit, Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung usw.) und praktisch am Wettbewerb um die Mittel teilnehmen. Dafür tut sich, wie wir nun zeigen wollen, ein neues Feld der Auseinandersetzung auf.
II. Die „Säulen“ der gesellschaftlichen Teilhabe im Gesellschaftsdenken der LINKEN oder: Was fehlt
Ein wichtiger Grundgedanke, der sich durch die Parteiprogrammatik zieht, ist der Gedanke der Teilhabe. Ausschluss von sozialer und politischer Partizipation muss bekämpft werden. Politische Partizipation findet durch demokratische Prozesse statt, eine Krise der Demokratie bedeutet daher immer auch verstärkter Ausschluss von Gesellschaftsmitgliedern. Die soziale Partizipation haben wir über Begriffe einer gelingenden Sozialintegration durch Arbeitsmärkte (Stichworte „Gute Arbeit“, „gute Löhne“ usw.) und durch den Sozialstaat betrachtet. Das ist auch richtig so, weil das Lohnarbeitsverhältnis, obgleich Herrschaftsverhältnis, auch das primäre gesellschaftliche Verhältnis ist, das die Verteilung von Einkommen steuert. Der Sozialstaat hat demgegenüber (eben weil das Lohnarbeitsverhältnis Ungleichheit erzeugt) eine umverteilende, ausgleichende Rolle und übt Kompensationsfunktionen bei Risiken aus, soll ein würdiges Leben nach Beendigung der Arbeitsbiographie absichern.
Weil das seit nunmehr mehreren Jahrzehnten immer weniger gut funktioniert, ist in den letzten Jahren, gerade aufgrund der neoliberalen Modernisierung, ein weiteres Feld sichtbarer geworden – das der sogen. Commons.
Commons sind Güter, die, im Gegensatz zu dinglichen Waren, nicht dadurch knapper werden, dass sie „konsumiert“ werden. Es sind teilbare Güter. Als Paradigma dient oft Wissen oder das Kunstwerk. Ob ein Gemälde von 10 oder 1000 Menschen am Tag rezipiert wird, ändert nichts an diesem Werk. Marx hat schon beschrieben, welche unentgeltlichen Ressourcen in die kapitalistische Verwertung einfließen, und dazu gehört neben der Produktivkraft kooperativer Arbeit auch die Verwandlung des menschlichen Wissens, der Wissenschaften insbesondere, in Produktivkräfte des Kapitals. Das Patentrecht bildet diesen Vorgang ab.
Das führt zu zum Teil desaströsen Folgen. Durch die Patentierung von Nutzpflanzen durch Agrarkonzerne wird in vielen Entwicklungsländern eine kleinbäuerliche Produktionsweise zerstört, was die Nahrungsmittelsouveränität dieser Länder gefährdet – von ökologischen Folgen ganz abgesehen. In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses Thema in Gestalt der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, insbesondere der öffentlichen Daseinsvorsorge ins Bewusstsein gerückt.
Neu ist, wie tradierte, wohlfahrtsstaatliche Praxen gesellschaftlicher Teilhabe („Das kann sich doch jeder leisten: Musikschule, gute Wohnung, Monatsticket, Tageszeitung, Internet, Kinobesuch usw.“) ihre Selbstverständlichkeit, Leichtigkeit, Normalität verlieren und wie dadurch die Frage sich auftut: Wie lässt sich denn der (gewohnte und für normal, d.h. als Anspruch Aller erkannte) gleiche Zugang zu diesen Gütern und Dienstleistungen , zu Commons halt, anders als über Staat (Steuermittel) oder Markt (Einkommen) herstellen?
Nach unserer Beobachtung wird im Ausland, auch in den wieder an Kraft zulegenden linken Szenen, die Bedeutung der Commons debattiert.
Eine moderne Linke muss unserer Auffassung nach die Positionen, die sie hat, auch als Beitrag zu diesem Komplex darstellen können.
III. Die Konzepte sind gut – aber wie gewinnen wir in der Situation der machtpolitischen Schwäche an Attraktivität?
Es gibt eine Paradoxie: Als sich die Debatte um den Atomausstieg drehte, hatten auch wir einen Plan, wie man die Atomkraft ganz schnell los wird. Wenn sich die Debatte wieder einmal um die Finanzierung von Gesundheit und Pflege dreht, haben wir ein Finanzierungskonzept. Wir haben ein Steuerkonzept, wir haben ein Rentenkonzept. Wir haben ein plausibles Mindestlohnkonzept, mit dem wir sowohl die Mindestforderung bzgl. Hartz IV-Regelsatzhöhe als auch die Frage der Altersarmut konzeptuell verkoppeln. Schließlich hat DIE LINKE die am meisten fortgeschrittene Krisendiagnose anzubieten, die unserer Kritik am Lissabon-Vertrag noch im Nachhinein Recht gibt. Und die aktuelle Debatte um Rechtsterrorismus, Verfassungsschutz und Blindheit auf dem rechten Auge zeigt, dass DIE LINKE bei diesem Thema keineswegs hysterisch, eher realistisch, war. Zumindest Elemente unserer Auffassungen sickern ein breitere Sektoren der veröffentlichten Meinung ein.
Alles gut, könnte man meinen. Aber wir haben an unseren Ansichten über die gesellschaftliche Entwicklung keine Eigentumsrechte. Im „Tagesspiegel“ kann eben schon einmal ein längerer Artikel über die „Eurokrise“ stehen, der in weiten Teilen auch von uns hätte sein können, ohne dass der interessierte Leser etwas davon mitbekommen würde, dass da eine große Ähnlichkeit zu Linkspositionen besteht. Das liegt nicht nur an einer Blockadementalität von Medien. Ebenso gut kann der Autor eines solchen Artikels sich zwar für die Krise interessieren, nicht aber für die LINKE. Und selbst wenn: Wen von unseren potenziellen Wählern würde es interessieren, wenn einige wenige Professoren plötzlich erkennen, dass DIE LINKE offenbar ein paar helle Köpfe in ihren Reihen hat?
Wenn wir in Umfragen nicht steigen, dann heißt das, dass das Richtige, was wir wissen, nicht das Interesse an uns steigert. Das ist keine Aufforderung, Unsinn zu erzählen oder die Arbeit an politischer Aufklärung einzustellen. Im Gegenteil, die muss sogar intensiviert werden.
Unser Problem ist, dass zwischen den ambitionierten Vorstellungen der LINKEN, deren möglicher Nutzen wohl breiter erkannt wird und der realen Durchsetzungsmacht, also der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzen eintritt, ein krasses Missverhältnis herrscht. Dass das von vielen Wählerinnen und Wählern auch so wahrgenommen wird, zeigen Umfragen. Und das ist für Wählerinnen und Wähler ein größeres Problem als für Geschichtsphilosophen.
Daher bedürfen wir einer ergänzenden Perspektive, in der wir politische Arbeit konzipieren.
Diese ergänzende Perspektive muss ihren Ausgangspunkt bei dem Bewusstsein für Unsicherheiten und Unwägbarkeiten des Lebens und den Arten und Weisen, wie Menschen darauf alltagspraktisch reagieren, gerade in Krisenzeiten, nehmen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern, auch den in Deutschland lebenden, ist die Krise selbstverständlich angekommen. Sie haben Erwartungen bezüglich und Einstellungen (im Wortsinne!) auf allgemeine Entwicklungen (wirtschaftliche Lage, Entwicklung der Renten, der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der Preise für Energie, Wasser usw., des Arbeitsmarktes der Wohnungen, Einkommen usw.). Im Kern dominiert die Orientierung auf Ordnung, Stabilität und Sicherheit (des Vorhandenen). Und die Leute haben entsprechende Verhaltensweisen und -muster zur Durchsetzung dieser Orientierung, zur Sicherung ihrer eigenen Existenz, entwickelt. Sie leben die Krise, individuell und kollektiv.
Die entwickelten und praktizierten Verhaltensweisen betreffen einerseits genau die allgemeinen Bereiche der Gesellschaft. Da wird mehrheitlich nicht auf den Bereich der politischen Demokratie, auf Politik, Parteien usw. gesetzt. Aber es gibt eben auch, innerlich wohl unterstützt von Vielen, den Protest von aktiven Minderheiten (Occupy, 99% usw.), in hunderten von Bürgerinitiativen forciertes Engagement für radikal andere Lösungen (BGE) oder ein markantes (partei-)politisches Engagement für Freiheits-, Bürger- und Beteiligungsrechte, für Commons (Piraten). Weniger spektakulär, dafür breiter, ist das Feld der Initiativen, lokal, regional, demokratische Gesellschaftsformen zu entwickeln, d.h. den eigenen Lebens-, Arbeits- oder Versorgungsbereich als Gleiche selbstbestimmt zu gestalten (Energiedörfer, Kulturprojekte, Genossenschaften, Kinderläden, Stadtteilarbeit, Lärmschutz, S21). Andererseits, das überwiegt, reagieren Menschen privat auf die Krise, durch Spar-, Vorsorge- und Einkaufsverhalten, sogen. Coping-Strategien (der Angst- und Stressreduktion). All das müssen wir als Partei zur Kenntnis nehmen, es aggregieren sich auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger Erwartungen, Einstellungen, Präferenzen für bestimmte Lösungen gegenüber der Politik, auf die die LINKE mit Angeboten reagieren muss. Und es bündeln sich bei der Bürgerschaft Kompetenzen, eigene Kompetenzen, mit der Krise erfolgreich umzugehen. Diese Kompetenzen gilt es zu stärken und zu nutzen.
Fragen, die regelmäßig in der veröffentlichten Meinung diskutiert werden
– gute Versorgung mit medizinischen Ressourcen
– Gefährdung der Rentenansprüche aus (teil-)privatisierten Rentenversicherungen (in Folge der Krise)
– Sicherung von Spareinlagen
– Entschuldung von Kommunen („Was bei Banken geht, geht nicht bei Kommunen?“)
– Preisentwicklung und Energiesicherheit bei Atomausstieg
– Preisentwicklung bei ökologischem Umbau
– Welche „Konversionsangebote“ kann man bei Massenentlassung bei Energieriesen machen?
– Steigt die Arbeitslosigkeit beim Mindestlohn? Welche „Anpassungsleistungen“ in Gestalt von Wirtschaftsförderung ist bei Mindestlohnpolitik in KMU nötig?
Derartige Vorschläge überbrücken nicht die grundsätzliche Differenz zwischen Ziel und Macht, sie machen sie aber etwas kleiner. Und das wird für eine kleine Partei wie die LINKE wichtig, weil die Krise das Sensorium der Bürgerinnen und Bürger für die Proportion von Nutzen und Wahrscheinlichkeit linker Politikangebote schärft.
Vor allem dürfen wir keine Angst vor Widersprüchen haben. Die Forderung nach einem erhöhten Regelsatz für Hartz IV- Bezieherinnen und Bezieher ist kein Verrat an der Forderung, dass Harzt IV weg muss. Mit einer solchen Forderung kann man aber besser Konkurrenten unter Druck setzen, und man kann weitere Forderungen nach einem anständigen Mindestlohn plausibler machen. Gleiches gilt für die Forderung, das Sanktions- und Repressionsregime, dem die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV unterworfen sind, zu überwinden. Auch das ist kein Verrat an der „Weg mit Hartz IV“-Forderung. In diesem Sinn müssen wir konsequenter in Etappenfolgen denken lernen. Das stärkt uns und macht die Konzepte, die da sind, für Wählerinnen und Wähler am Ende auch attraktiver.
IV. Wie also praktisch weiter?
Sieht man sich die Liste der ParlaIinis der laufenden Legislaturperiode an, so fallen eine Vielzahl (deutlich nicht die Mehrzahl) von Anträgen und GEs auf, die sogen. Ein-Punkt-Anträge sind. Solche zielen in der Regel auf bestimmte (kleinere) Gruppen, die einen konkreten Nutzen davon hätten. Das sind, bei einer linken Partei nicht überraschend, diskriminierte Minderheiten, Gruppen ohne Lobby. Aber es sind auch regional oder lokal fokussierte Initiativen. Also das, was man gemeinhin als linken Klientelismus bezeichnen würde. Ein Teil davon erfüllt dieses Kriterium darum nicht, weil der Austausch Leistung gegen Wählerstimmen kaum intendiert ist. Hier ist Potential.
Der Teil der Inis, der gewissermaßen massenwirksam konzipert ist, größere Gesellschaftsbereiche betrifft, die Allokation von Steuermitteln , gesetzliche Regelungen usw., leidet tatsächlich oft daran, dass diese mit einer „Alles oder Nichts“ – Perspektive versehen sind: Systemwechsel in jeweiligen Gesellschaftsbereichen. Es liegt Potential in diesen Anträgen, wenn man sie im beschriebenen Sinne durch singuläre Forderungen und Vorschläge komplettieren würde. Das ist bei einem Thema wie dem Verbot von Rüstungsexporten vergleichsweise einfach, wir fordern darum auch (erst einmal) Exportverbote einzelner Waffen (in einzelne Regionen). Das scheint auf anderen Gebieten schwieriger, etwa wenn wir die Abschaffung von Praxisgebühr und Zuzahlungen (zunächst) für bestimmte Krankengruppen fordern würden (etwa die 6 Mio. Diabetiker). Das erschiene ungerecht gegenüber andern Gruppen. Faktisch würde es aber eine Reduzierung von Ungerechtigkeit bedeuten, ein Mehr an Gleichheit. Dialektisch und also schwierig. Ein weiteres Beispiel wäre die Forderung nach Garantie erworbener Ansprüche aus privater Rentenversicherung für die sogen. kleinen Leute. Oder die pauschale Zuweisung einiger Rentenpunkte an die Leute mit geringsten Rentenansprüchen für einige Jahrgänge. Ein Schritt weg von drohender Altersarmut für Viele und für diese attraktiver als ein Systemwechsel, der für sie selbst wenig wahrscheinlich, also praktisch bedeutungslos wäre.
Wäre das nicht auch in andern Feldern zu diskutieren? Stünde die LINKE nicht möglicherweise als Partei der konkreten Schritte hin zu einer anderen Gesellschaft da? DIE LINKE muss für ihre Wählerschaft als beides zugleich erscheinen: Die Partei, die eine andere Gesellschaft will, die Partei, die erste Schritte dorthin sucht.